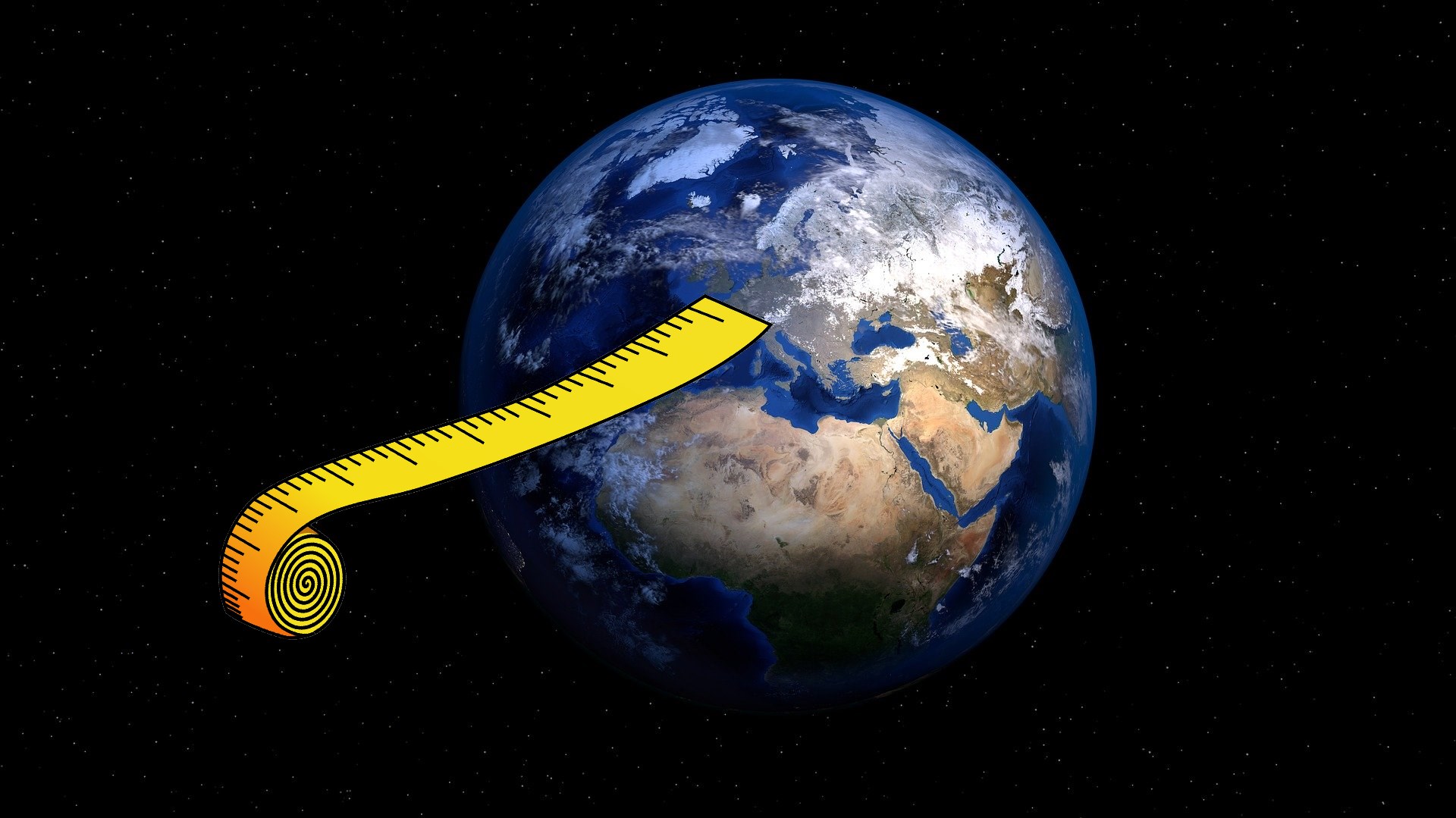Im letzten Beitrag von Weltallwissend habe ich euch erklärt, wie man mithilfe der Parallaxe die Entfernung zu einem Objekt im Weltall messen kann (siehe Weltallwissend 09 “Entfernungsmessung in der Astronomie – Teil 1: Wie weit ist es zu den Sternen?“). Bei dieser Methode gibt es aber ein Problem: Je weiter ein Stern von uns weg ist, desto geringer wird der Effekt, mit dem wir seine Entfernung messen können. Bei den gewaltigen Entfernungen der Sterne wird dabei sehr schnell ein Punkt erreicht, an dem wir selbst mit den besten Teleskopen nicht den kleinsten Unterschied messen können. Wir müssen nun also zu anderen Mitteln greifen.
Ein weiterer Punkt, an dem wir uns orientieren könnten, wäre die Helligkeit eines Sternes am Himmel, die sogenannte „scheinbare Helligkeit“. Schließlich erscheint ein Stern umso heller, je näher er uns ist. Die Sonne beispielsweise ist eigentlich ein durchschnittlicher Stern, der einzige Unterschied zu anderen Sternen ist aus unserer Sicht, dass sie uns viel näher ist als andere Sterne.
Da gibt es aber noch kein Problem: Die scheinbare Helligkeit hängt ja nicht nur von der Entfernung des Sterns ab, sondern auch von dessen „absoluter Helligkeit“, also wie hell er vor Ort ist. Wenn wir also die absolute Helligkeit eines Sternes kennen, können wir aus ihr und der scheinbaren Helligkeit des Sternes seine Entfernung berechnen. Heute bezeichnet man Objekte, deren absolute Helligkeit wir kennen, als Standard-Kerzen.
An diesem Punkt steckten die Astronomen aber sehr lange fest, denn sie kannten damals noch keine Standard-Kerzen. Das änderte sich erst, als die Astronomin Henrietta Swan Leavitt 1912 sogenannte „veränderliche Sterne“ oder „Cepheiden“ in der Kleinen Magellanschen Wolke beobachtete. Das sind ganz einfach Sterne, die ihre Helligkeit verändern, mal werden sie heller und dann wieder dunkler. Henrietta Leavitt fiel bei diesen veränderlichen Sternen nun auf, dass die Dauer einer Periode dieser Helligkeitsschwankungen eng mit der Helligkeit zusammenzuhängen schien. Je heller ein Stern war, desto langsamer änderte er seine Helligkeit.
Doch bei diesem Vergleich der Helligkeit handelt es sich ja um die scheinbare Helligkeit und nicht um die absolute Helligkeit. Wer sagt uns also, dass diese „helleren“ Sterne nicht einfach näher an uns dran sind? Ganz einfach: Henrietta Leavitt hat nur Sterne in der Kleinen Magellanschen Wolke beobachtet, einer Zwerggalaxie, wie wir heute wissen. Und auch wenn man damals noch keinen blassen Schimmer hatte, wie weit sie von uns entfernt war, konnte Leavitt doch davon ausgehen, dass alle Sterne in dieser Ansammlung ungefähr gleich weit von uns entfernt sind und sie also wirklich das Verhältnis ihrer absoluten Helligkeiten beobachtet.
Heute kennen wir noch weitere Standard-Kerzen. Ein weiteres Beispiel ist eine bestimmte Art von Supernovae, und zwar eine Supernova vom Typ 1a. Normalerweise passiert eine Supernova am Ende des Lebens von einem sehr massereichen Stern. Leichtere Sterne (wie auch unsere Sonne) pusten einfach ihre äußeren Schichten ins All, der Kern bleibt als Weißer Zwerg übrig und kühlt langsam aus. Es sei denn, der Weiße Zwerg befindet sich in einem Doppelsternsystem. Dann kann es passieren, dass von dem anderen Stern Material auf den Weißen Zwerg fällt und dieser somit wieder schwerer wird. Dabei kann er eine bestimmte Masse erreichen, mit der er doch wieder schwer genug für eine Supernova ist und gewissermaßen nachträglich noch explodiert. Da es immer die gleiche Masse ist, bei der ein Weißer Zwerg noch explodiert, sind diese Supernovae vom Typ 1a immer genau gleich hell! Damit handelt es sich hier auch um eine Standard-Kerze.
Damit konnte auch ein großes Rätsel in der Astronomie gelöst werden: Es ging um nichts geringeres als das Universum selbst. Astronomen waren sich nämlich sehr lange nicht einig, ob die Milchstraße das gesamte Universum ausfüllt oder ob es außerhalb davon noch etwas gibt. Man hat zwar viele Nebel beobachtet, von denen wir heute wissen, dass es sich bei ihnen um andere Galaxien handelt und viele haben auch vermutet, dass das andere Galaxien außerhalb der Milchstraße sind. Allerdings dachten auch viele Forscher, das wären einfach Ansammlungen von Sternen in unserer Milchstraße. Dank Henrietta Leavitt konnte nun endlich die Entfernung zu diesen Nebeln gemessen werden. Edwin Hubble beobachtete 1925 Cepheiden in der Andromedagalaxie und zeigte, dass diese über 2 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und damit eindeutig außerhalb der Milchstraße ist. Das Universum war also noch viel größer, als man es sich vorgestellt hatte.
Mit dieser Methode kann man zu sehr vielen Galaxien in der näheren Umgebung der Milchstraße die Entfernung messen. Jedoch hat auch sie einen Haken: Sie lässt sich nur anwenden, wenn wir in der Galaxie einzelne Sterne noch erkennen können, damit wir zum Beispiel Cepheiden erkennen können. Aber bei Galaxien, die noch viel weiter weg sind, ist wirklich nicht daran zu denken, irgendwie einzelne Sterne zu erkennen. Wir haben also kein Objekt, dessen absolute Helligkeit wir erkennen können. Was nun?
Hier müssen wir die Entfernung wieder auf eine ganz andere Art messen – und zwar mit den Spektrallinien (für „Spektrallinien“ siehe Weltallwissend 03/2020 – Dunkle Linien im Sonnenspektrum und die Entdeckung des Heliums).
Eine Spiralgalaxie rotiert ja. Das heißt, eine Seite bewegt sich auf uns zu, die andere Seite von uns weg. Zwar bewegen sich fast alle Galaxien von uns weg, aber trotzdem herrscht zumindest noch, bezogen auf uns, eine Relativbewegung zwischen den beiden Seiten. Dadurch geschieht mit dem Licht nun etwas interessantes: Auf der Seite, die sich auf uns zu bewegt, wird das Licht etwas gestaucht, die Wellenlängen (von denen ja die Farben abhängen) werden kürzer, auf der anderen Seite hingegen wird es in die Länge gezogen, die Wellen werden länger. Man nennt das den Doppler-Effekt. Das wirkt sich auch auf die Spektrallinien aus, die dadurch etwas verschoben werden.
Fassen wir das ganze nochmal zusammen: Die Spektrallinien einer fernen Galaxie werden im Spektrum relativ zu uns verschoben, und zwar auf einer Seite der Galaxie anders als auf der anderen. Wenn wir nun eine Spektralanalyse dieser Galaxie machen, also messen, wo im Spektrum sich die Spektrallinien befinden, sehen wir dadurch nicht mehr klare Linien, sondern dunkle Bereiche mit verschwommenen Grenzen.
Diese Bereiche sind umso größer, je schneller die Galaxie rotiert, da das Licht dann ja stärker gestaucht und in die Länge gezogen wird. Die Galaxie rotiert wiederum umso schneller, je schwerer sie ist. Sie ist umso schwerer, je mehr Sterne sie enthält. Und je mehr Sterne die Galaxie enthält, desto heller leuchtet sie. Somit haben wir auf indirektem Weg wieder eine Standard-Kerze, deren absolute Helligkeit wir kennen und deren Entfernung wir somit berechnen können! Dieser Zusammenhang zwischen der Rotationsgeschwindigkeit und Leuchtkraft einer Galaxie wird als Tully-Fisher-Relation bezeichnet.
Mit den Spektrallinien konnte man übrigens auch herausfinden, dass sich fast alle Galaxien von uns entfernen. Edwin Hubble maß einfach, wie weit und in welche Richtung die Spektrallinien im Spektrum verschoben sind entdeckte dadurch, dass sich fast alle Galaxien von uns entfernen. Wie wir heute wissen, entfernen sich aber nicht die Galaxien selbst von uns, sondern der Raum zwischen uns und ihnen dehnt sich aus. Daher handelt es sich bei dieser „Rotverschiebung“ nicht um den Doppler-Effekt, sondern die Wellen werden mit dem Raum in die Länge gezogen.
Aber ihr merkt wahrscheinlich schon, wie ungenau diese Methode ist. Aber wenn man es genau bedenkt, wird die Entfernungsmessung bei solch gewaltigen Entfernungen sogar noch viel schwieriger, als es auf den ersten Blick wirkt
1929 wies Edwin Hubble nach, dass sich alle Galaxien von uns entfernen – und dass sie sich umso schneller von uns entfernen, je weiter sie bereits von uns entfernt sind. Das heißt, dass sich jede Galaxie von jeder anderen entfernt! (siehe Weltallwissend 08 „Dunkle Energie”) Eine Ausnahme bilden Galaxien, die sich besonders nahe sind, sodass die Gravitation überwiegt. Ein Beispiel dafür sind die Milchstraße und die Andromedagalaxie.
Bei den Entfernungen zu Galaxien, die wir jetzt messen wollen, geht es aber schon um Zahlen in einer Größenordnung von bis zu mehreren Milliarden Lichtjahren! Das Licht der Galaxie braucht also mehrere Milliarden Jahre, um uns zu erreichen. Da wir die Entfernung nur anhand dieses Lichtes messen können und die Galaxie sich in der Zwischenzeit wieder weiter von uns entfernt hat, messen wir nur die Entfernung der Galaxie vor mehreren Milliarden Jahren, mittlerweile ist sie jedoch viel weiter entfernt.
Und es gibt noch ein weiteres Problem: Mit weit entfernten Galaxien wollten Astronomen berechnen, wie schnell das Universum momentan expandiert. Das konnten sie mit zwei unterschiedlichen Methoden tun, sie müssten also mit beiden Methoden ungefähr auf das gleiche Ergebnis gekommen – doch es waren komplett unterschiedliche Ergebnisse, die sie gemessen haben. Der Grund dafür könnte sein, dass die Theorie, auf die sich die Annahme stützt, man müsse mit beiden Methoden auf das gleiche Ergebnis kommen, bei solch gewaltigen Maßstäben (immerhin geht es um das gesamte beobachtbare Universum) ihre Gültigkeit verliert – und dabei handelt es sich um keine geringere als Albert Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie! Verbirgt sich in den Messungen von so fernen Galaxien eine neue Physik? Ich denke, egal was da noch kommt, einer Sache können wir uns sicher sein: Der theoretischen Physik steht eine sehr spannende Zeit bevor…
Quellen:
- Josef Gaßner, Jörn Müller: Können wir die Welt verstehen? – Meilensteine der Physik von Aristoteles zur Stringtheorie (Buch)
- Sternengeschichten (Podcast von Florian Freistetter) Folgen 19-21
- https://www.spektrum.de/lexikon/physik/tully-fisher-relation/14810
- https://www.spektrum.de/magazin/edwin-hubble-und-die-expansion-des-universums/821083
- Livestream-Vortrag „Wie schnell expandiert das Universum?“ von Bruno Deiss im Physikalischen Verein: https://www.youtube.com/watch?v=S6tz2HpXQ4Y&t=1133s